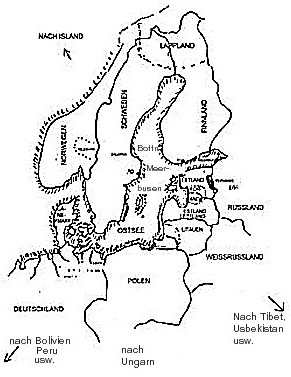Gewebte
Bänder von und bei Anneliese Bläse
Hier
bist Du eingeladen auf
eine Reise rund um die Ostsee, um kurz mal zu
gucken,
wer da wo Bänder gewebt hat oder heute noch webt. Mit der Zeit werde
ich für einzelne Stationen noch weitere Links installieren mit
genaueren Informationen über Band, Land und Leute

Bandweben
rund um die Ostsee
Klick
auf die blauen Wörter öffnet jeweils ein dazu passendes Bild. Klicken
Sie dann auf den allgemeinen "zurück"-Knopf
Gewebte Bänder in bunten Farben und Mustern waren rund
um die Ostsee täglich im Gebrauch, bis vor
knapp 200 Jahren durch die Industriealisierung, wie so vieles, auch
diese
kunstvolle Handarbeit der Frauen in Vergessenheit geriet. Nur an
wenigen Orten, vorwiegend in Skandinavien und im Baltikum, haben sich
Reste davon erhalten.
In
deutschen Heimatmuseen liegt so manches liebevoll
gestaltete WERKZEUG,
doch die
wenigsten Museumsmitarbeiter
oder
-Besucher wissen noch, wozu und wie es gebraucht wurde. Deshalb
verschwinden
diese kleinen Kostbarkeiten meistens in den Archiven und werden dort
vergessen.
Die Völker im Ostseeraum hatten
schon
vor mehr als 1000 Jahren untereinander
gute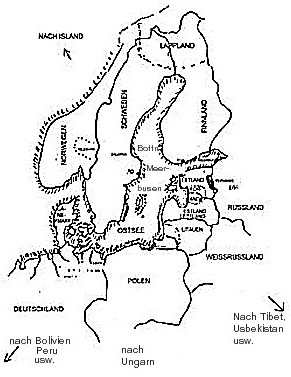 Kontakte,
das
läßt sich unter anderem deutlich ablesen an der
Art,
wie sie ihre Bänder webten. Die uralten Muster finden sich
in allen Ländern um die Ostsee ebenso wieder, wie auf der ganzen
Welt, aber die Art, wie sie gebildet
werden durch
die besondere Anordnung der Kettfäden beim
Weben, die ist in anderen
Gegenden kaum
bekannt.
Kontakte,
das
läßt sich unter anderem deutlich ablesen an der
Art,
wie sie ihre Bänder webten. Die uralten Muster finden sich
in allen Ländern um die Ostsee ebenso wieder, wie auf der ganzen
Welt, aber die Art, wie sie gebildet
werden durch
die besondere Anordnung der Kettfäden beim
Weben, die ist in anderen
Gegenden kaum
bekannt.
Bei meinen bescheidenen
Versuchen, in den Ländern rund um die
Ostsee Bandwebereien aufzuspüren, habe ich die meisten Muster in
ESTLAND
gefunden, weil ich dort gute Kontakte habe, und weil die Esten
stolz sind, dass bei ihnen die Bandweberei noch ausgeübt
wird. Material
ist
ungemein
reichhaltig zu finden, denn den Esten, welche es fertig gebracht
haben, unter
800 Jahren Fremdherrschaft ihre Eigenheit nicht zuverlieren, halfen
ihre Volkstrachten wie ihre Lieder zur Bewahrung ihrer Identität.
Und
zur Tracht
gehören nach wie vor die gewebten Gürtel für Frauen und Männer in fast
allen Regionen des kleinen Landes. Ich selbst habe ein Heft mit über 80
verschiedenen Mustern aus Estland zusammengetragen, von Fotos
und anderen Abbildungen ausgezählt und webgerecht
aufgezeichnet, Heft 5
aus der Reihe Band rund um die
Ostsee.
Von LETTLANDweiß
ich,
dass es auch dort eine ungebrochene Tradition der
Bandweberei mit unzähligen Mustern gibt, hatte aber bisher kaum
Gelegenheit, sie kennen
zu lernen. Zwei Bänder finden sich bei den Bildern. Der Verband
ausgewenderter Letten in Kanada hat ein prachtvolles Buch über
die Gürtel und Bänder der Letten herausgegeben.
das ich mir einmal kurz ansehen durfte. Leider ist das Werk hier
im Buchhandel nicht zu bekommen. Wer hat Verbindung nach Kanada
und kann mir weiterhelfen?
Von LITAUEN hat
Hildegund Hergenhan 2
Hefte mit Mustern
ausgezählt und gezeichnet, Heft 3 und 4 aus der Reihe Band rund um die Ostsee.
Neben den
allgemein beliebten haben
sich dort noch
einige
ganz eigene
Muster, sowie das Weben mit der dreifarbigen Kette erhalten, siehe
dort. Außerdem
kennt man in Litauen eine komplzierte Mischform zwischen
Brettchenweberei und Leinengewebe: die gleichen Muster wie für den
Kamm werden mit der Hand in ein Brettchenband
eingelegt.
In RUSSLAND,
das heißt in der Ukraine, in Weißrussland und
dem nördlichen Russland bis hinauf zum Eismeer hat es eine
reiche Bandwebtradition gegeben. Die Altgläubigen, eine Sekte,
weloche entstanden ist, als Peter der Große "das Tor nach Westen
öffnen" wollte und deshalb viele Verbote alter Sitten
erließ, unter denen gerade die traditionsbewussten
Staatsbürger zu leiden hatten. Während der Stalinaera sind
die meisten Altgläubigen dann ausgewandert, und zwar vorwiegend
durchs Hintertürchen, über China, nach Amerika. Dort leben
sie heute noch in Oregon und in Brasilien, aber ihre spezielle Kultur
ist trotzdem am absterben. Waren gewebte Gürtel früher unter
anderem auch ein Identitätsmerkmal der einzenen Stämme
und Großfamilien, so kaufen die Altgläubigen in Oregon ihre
Gürtel jetzt bei denen in Brasilien, weil die jungen Leute nicht
mehr weben lernen wollen, und sie achten nicht mehr darauf, die
richtigen Muster zu bekommen. (Quelle Kate Hooker).
Das Staatliche Ethnographische Museum in St. Petersburg besitzt
über 100 000 Gegenstände aus dem Siedlungsgebiet der
Osteuropäischen Slawen, darunter ein großer Prozentsatz von
Textilien. Ich habe ein Büchlein kaufen können, in dem der
Leiter des Museums, Oleg Lysenko, das Ergebnis seiner Forschungen
zusammenfassend darstellt und versuche zur Zeit, das "russische
Englisch" ind Deutsche zu übertragen, damit ich dann klar
darüber berichten kann. Das kann noch eine Weile dauern, denn die
Russin, welche die Übersetzung ins Englische besorgt hat, hat sich
nicht die Mühe gemacht, englische Fachwörter
aufzuspüren, sondern einfach die russischen Fachausdrücke in
unserer Schrift hingeschrieben. Wenn ich fertig bin, kann ich sicher
auch auf russsisch weben. Dann gibt es einen neuen Artikel mit ganz
neuen Gesichtspunkten.
In OSTPREUSSEN
war die Bandweberei noch bis ins 20. Jahrhundert lebendig, ja es
scheint sich neben der ursprünglich ländlichen Volkskunst auch eine
mehr städtisch geprägte Richtung entwickelt zu haben, die wohl mit der
Jugendbewegung verknüpft war. Die berühmte Webschule in Lyck hat mit
Sicherheit diese Entwicklung auch gefördert. In keinem Land gab es so
viele
verschiedene Muster
mit nur 9 Musterfäden, wie bei den Ostpreussen mit ihren Jostenbändern,
den
schmalen Gürteln zur Mädchentracht, (Juosta = litauisch Gürtel). Im
Unterschied zu den ursprünglich überall fast immer rot auf weissem
Grund gewebten traditionellen Mustern fanden sich Jostenbänder in einer
Fülle verschiedener Farbzusammenstellungen. Offenbar war es auch
üblich, Musterbänder zu
weben, im gleichen Sinne wie die altbekannten Stickmustertücher. Einige
davon, z. B. das Memellandband und das Agnes-Miegel-Band, auf dem sich
über 60verschiedene Muster finden, sind mit dem
Treck in den
Westen gekommen. Sie wurden zur Grundlage des weiter unten erwähnten
Kurses in Travemünde.
Ob die Polen selbst Bänder
gewebt haben, ist mir bis jetzt nicht klar. An den Tanztrachen, mit
denen sie heute auftreten, habe ich keine bemerkt. Zu oft wurde ihr
Reich zerteilt und von den großen Nachbarn verschoben. Im
Polen waren die
Kaschuben zuhause, über welche man in den Museen die
offizielle Auskunft erhält,
dass die dort
ausgestellten reich verzierten Webekämme von ihnen stammen. Auch ein
Stück
vom
alten KURLAND
gehört jetzt
zu
Polen, dort fand
ich Muster aus der Zeit um 1902.
Es heißt zwar,
Pommerland ist abgebrannt, die gute alte Zeit verweht, vergessen aber POMMERN
hatte mit Sicherheit eine
alte Tradition der Bandweberei. Sie ist auch in der Literatur belegt
und
geht mindestens bis in die Schwedenzeit zurück. Hier an der Küste habe
die Frauen der Fischer als erste die NETZNADEL ihrer Männer als
Webeschiffchen
benutzt, und damit die Bandweberei technisch einen großen Schritt
vorwärts gebracht.
Hildegund Hergenhan, geboren
in Hinterpommern, aufgewachsen in
Schleswig-Holstein,
hat die Spuren der Bänder in ihrer früheren Heimat
jahrelang gründlich erforscht und in Ihrem Buch
»Upschöttels, Band in Pommern«
anschaulich beschrieben. Auch über Vorpommern
hat Hildegund
Hergenhan in ihrem Buch berichtet. Die
MÖNCHGUTER
ROSE hat
sie (wieder)entdeckt und beschrieben. Viel von der alten
Bandwebkunst ist von Flüchtlingen mit dem großen
Treck nach dem 2. Weltkrieg nach Holstein und
Westdeutschland
mitgebracht worden, und im
Pommernzentrum in Travemünde läuft jedes Jahr ein Kurs im Kammbandweben, ursprünglich
gehalten von Sigrid Albinus, der Witwe
des Leiters des Ostpreußenmuseums in Lüneburg, die sich sehr um die
Erhaltung und Dokumentation der alten Bänder verdient gemacht hat. Seit
sie aus
Altersgründen aufgehört hat, übernahm
Hildegund Hergenhan den
Unterricht.
Von Bandweberei in Mecklenburg
ist mir leider gar nichts bekannt.
Auch bei uns in SCHLESWIG-HOLSTEIN
hier ist es schwierig, noch etwas zu finden. Im Museum
in
Flensburg
soll es wunderschöne WEBEKÄMME
geben, siehe auch oben, (Zeile 5, unter
Werkzeug) - die
Abbildung
stammt aus einem alten Buch. Leider waren sie nie ausgestellt, weder
als ich vor etwa 10 Jahren dort war, noch als meine Kinder
im vergangenen Jahr danach suchten. Ich selbst besitze einen über 200
Jahre
alten Kamm aus Munkbrarup in Angeln, ein schlichtes Arbeitsgerät. Im
Kreimuseum Plön befindet sich ein sehr ähnliches Modell, welches aus
Wankendorf stammt, Alter
unbekannt. Ich besitze ein auch Bild von einem
mit Kerbschnitt
verzierten
Webekamm aus
Neuenkirchen in NORDFRIESLAND
aus
dem
18. Jahrhundert, der sich im
Landesmuseum in Schleswig
befinden
soll. Das Alter all dieser Kämme deutet
darauf hin, dass die Bandwebekunst bereits im 19. Jahrhundert in
Vergessenheit geriet. Von überlieferten Bändern konnte ich bisher
nichts in Erfahrung bringen. Sie waren ja meist Gebrauchsgegenstände
und sind
zerschlissen.
Die Bandweberei muss
jedoch zumindest
in Deutschland, Frankreich und Spanien im
15. und 16. Jahrhundert ganz allgemein zur Ausbildung von jungen Damen
gehobener Kreise gehört haben, denn um
1509
hat Lukas Cranach
in Wittenberg als Hofmaler des Kurfürsten von Sachsen die
Jungfrau MARIA
als Bandweberin
gemalt auf einem 70 cm hohen Tafelbild unter die Titel »Die Erziehung
der Maria«. In alten
Stundenbüchern und
auf Kirchenfenstern sind viele Bänder webende Marien zu finden, die
meisten arbeiten zwar mit Brettchen, aber einige weben auch Kettrips
auf
verschiedenen kleinen Webgeräten. Den Rückengurt kennt Maria allerdings
offenbar
nicht, der ist etwas für die kleinen Leute. Maria wurde zu jener Zeit,
im 15. und 16. Jahrhundert, immer
als etwas Besonderes dargestellt und somit automatisch als Dame der
gehobeneren Gesellschaft.
Mit Sicherheit habe ich
feststellen können, dass die Muster des
Ostseeraumes weiter im Süden Deutschlands nicht gewebt wurden. Man
kannte offenbar den Webekamm, hat aber nur schmale Bänder in schlichtem
Kettrips gewebt.
Schauen wir nach DÄNEMARK, ist
es fast genauso schwierig, etwas zu finden. Dort lebt zwar Lise
Knudzen-Ræder, eine
ausgezeichnete
Brettchenweberin, die
sich um die archäologischen
Funde im Grab des Keltenfürsten von Hochdorf verdient gemacht
hat, indem sie die wunderschönen Bänder von 550 vor Christus nachwebte.
Aber Kettripsbänder
habe ich
bisher noch in keinem Heimatmuseum gefunden, nur
spärlich etwas
Werkzeug. In den Freilichtmuseen sitzen die Brettchenweberinnen. Aber
die Dänen haben auch mit dem Kamm gewebt, früher mal,
genau wie unsere Vorfahren. Wer kann mir da weiterhelfen?
In
NORWEGEN (rund
um die Ostsee - den
Oslofjord zählen wir noch dazu...) bin
ich fündig
geworden, im Nationalmuseum in Oslo und im Museum der EIDSBORGKIRKAN,
einer Stabkirche in Telemark. Es gibt dort ein
sehr
aufschlussreiches Heftchen aus den frühen 1960er Jahren zu kaufen, in
welchem
ganz viele
verschiedene Methoden, Bänder herzustellen beschrieben sind, die
früher in dieser Gegend alle bekannt waren. Es ist im Telemarksdialekt
geschrieben
und deshalb sehr spannend zu entziffern, auch wenn man Norwegisch
lesen
kann. Mein Versuch, in Telemark Bandweberinnen persönlich
aufzusuchen,
kam zu spät. Unser Freund Olav hatte mir 1992 zwar versprochen,
bei
unserem nächsten Besuch wollte er mit mir zu den Bandweberinnen fahren.
Aber durch verschiedene Umstände
kam ich erst nach erst 7 Jahre später wieder nach Norwegen. Die alten
Frauen
waren
inzwischen gestorben. Zum
Trost
machte er mich mit THORKJELL SVEITSEN
bekannt, dem Brettchenweber im
Hedal.
Auch in SCHWEDEN hatte ich
Erfolg, zunächst im Nordiska Museum in Stockholm. Dort gibt
es eine große Trachtenausstellung und ich träume noch heute davon,
einige Tage
dort zuzubringen um die Muster der vielen ausgestellten Bänder
aufzuzeichnen. Dort
bekamen wir auch den Tipp, der unsere nächste Reise bestimmte: DALARNA
ist
die
wichtigste Gegend in Schweden für heute noch lebendiges »Krusband
vävning«.
Wir besuchten dort 7 kleine Museen in all den
kleinen
Städtchen rund um den Siljansee, und alle waren verschieden und hatten
verschiedene Bänder ausgestellt, alte und neu gewebte. Ein Musterheft
»DALARNA« habe ich in Arbeit.
Von Hildegund Hergenhan gibt es ein Musterheft
Schonen/Schweden, vorwiegend mit Mustern der
königlichen Gewänder im Museum von Lund, Heft
1 aus der Reihe Band rund um die
Ostsee.
Interessant für Schweden und
Norwegen finde ich das KONFIRMANDENBAND,
das wir in Norwegen und in
Schweden
fanden. Die Kirche hat das Anliegen aufgegriffen, die heutige
Jugend mit der uralten Bandwebekunst etwas vertraut zu machen.
Die meisten werden ja in der Tracht konfirmiert. Nun beginnen die
Mädchen schon bei der Anmeldung zum Konfirmandenunterricht damit, sich
das Schürzenband für ihre Tracht selbst zu weben.
Es ist ein sehr
einfaches Muster, gelb auf rot. Die Länge ist nicht vorgegeben, so
wurde ein Wettbewerb daraus, wer in dem einen Jahr bis
zur Konfirmation das
längste Band
schafft. Manche haben großen Ehrgeiz und sind fleißig, anderen ist es
egal, hörten wir.
In FINNLAND kamen wir
ganz
zufällig genau an dem Tag ins
Handwerkermuseum in Turku,
als die
Bandweberin im Hause war. Wir hatten ein nettes, langes Gespräch
miteinander. Wir tauschten Muster aus und ich erfuhr, dass man
sich bemüht, aus
dem Wenigen, was überliefert ist, das Beste zu machen und eifrig
weiter forscht. Außerdem war ich im Saaresseuri Museum, das hübsch auf
einer Insel vor Helsinki liegt. Dort traf ich einige fleißige Mädchen,
die sich abmühten, für Anfänger viel zu komplizierte überlieferte
Muster auf Bänder zu weben. Ich hoffe, sie haben nicht den Mut verloren
und es inzwischen besser
in den Griff bekommen.
Ein Volk im
Norden haben wir
noch nicht besucht, die
SAMI, die
man
früher Lappen (= Lumpenleute) nannte. In Schleswig, im Landesmuseum
Schloss
Gottorf ist ihnen eine Austellung gewidmet, wo sich neben dem
schönen Werkzeug auch
Bänder mit einfachen Mustern für die
Fellschuhe und komplizierte
dreiteilige Gürtel
finden.
Auch in Stockholm im Nordiska
Museum findet man in der
Sami-Abteilung fein
gearbeitete Webkämme
aus Rengeweih und verschiedene Bänder. Ich glaube, die Leute die den
Ausdruck Lappen prägten, haben nur von weitem hingeschaut. Wie kunstvoll
gearbeitet sind
doch die verschiedenen
Trachten der Sami! Sogar die Kordel, mit der die Frau ihren
bestickten Brustlatz befestigt, ist liebevoll handgeflochten.
Besonders freut mich, dass die Samestiftelse offenbar junge
Forscherinnen in verschiedene Regionen Lapplands geschickt hat,
um die in
jeder Region besondere
Art
des Webens und die Bänder
samt Mustern und
Fachausdrücken zu dokumentieren. Die Ergebnisse wurden als kleine,
feine
Bücher herausgegeben, die man kaufen kann. Im Jahr 2004 bin ich ganz
zufällig dreimal auf
solche Bücher aufmerksam gemacht worden,
die alle völlig verschieden sind
und die große Vielfalt der
samischen
Kultur deutlich machen.
Nicht
auf der Karte oben sind folgende Länder, in denen ich auch Nachweise
für
Bandweberei mit dem Kamm gefunden habe:
ISLAND
TIROL
FRANKREICH
MALLORCA
PORTUGAL
RUMÄNIEN
SLOWAKEI
TSCHECHIEN
MEXIKO
zurück zur Startseite