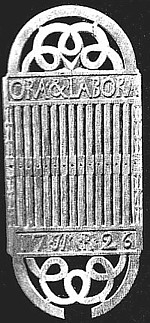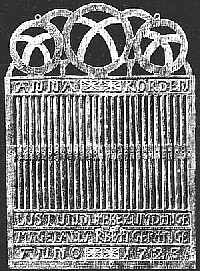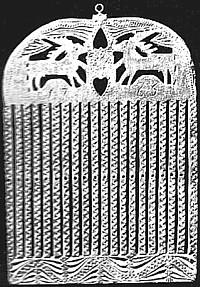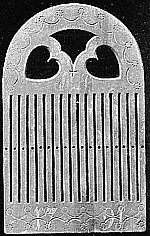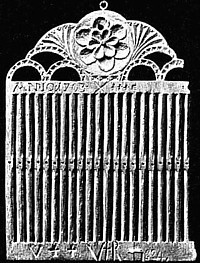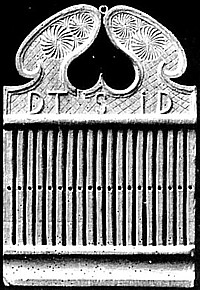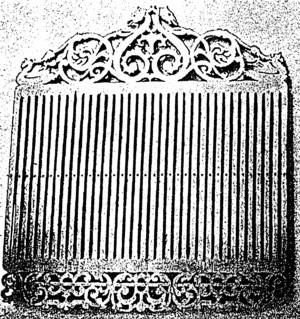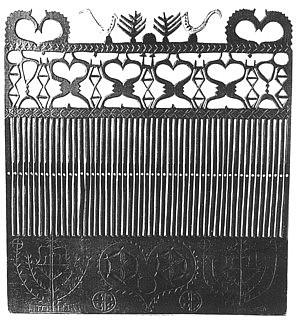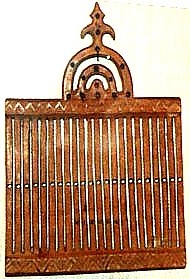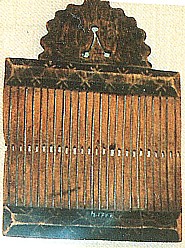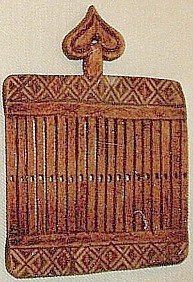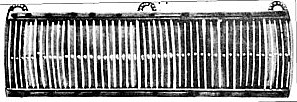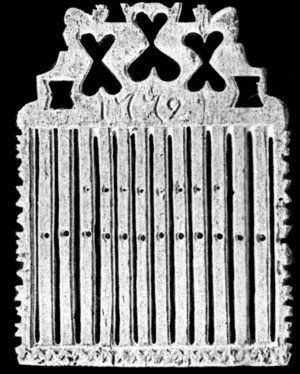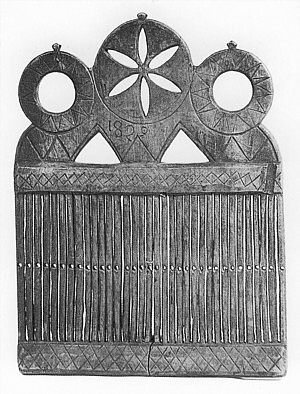Gewebte
Bänder rund um die Ostsee
Wegen der vielen Bilder bitte ich um etwas
Geduld
Aus meiner Schatzkiste:
ein
Stück Kulturgeschichte der Menschheit
Niemand weiß genau, wann
der Webekamm erfunden wurde.
Die ältesten
archäologischen Funde, die man bisher kennt, stammen aus
der Römerzeit.
Es sind meist kleine Bruchstücke, hergestellt aus Knochen, wie dieses hier rechts, es ist nur 6 cm
hoch.
Jennie Parry, BRAID
SOCIETY, England, hat es im Museum von London entdeckt und fotografiert.
Im Vergleich zum
Litzenstab mit vielen
beweglichen Fäden, die bei der Arbeit gewöhnlich dicht
zusammenrutschen, ist der steife Kamm, in Englisch Rigid Heddle, ein
großer Fortschritt für das Musterweben, weil er alle Webfäden immer im
gleichen Abstand hält. Anstatt bei jedem Schuss seitlich in das Fach zu
linsen, welche Fäden man nach oben zu holen hat, kann man jetzt von
oben durch die Kette das untere Fadenlager deutlich sehen und braucht
nur mit der Spitze des Schiffchens die gewünschten Fäden heraufholen zu
denen, die im oberen Lager bereits vorhanden sind. Es braucht ein
bisschen Übung, die Augen daran zu gewöhnen, aber genau diese Übung ist
gesund für den Augenmuskel, hat mir ein Facharzt gesagt. Nur sollte man
bei dieser Arbeit keine Gleitsichtbrille tragen, das strengt die
Halsmuskeln zu sehr an.
Manche
der kunstvoll ausgesägten oder geschnitzten Webekämme, die man heute in
Museen findet,
sind nur etwas für das Auge und taugen nicht zu
ernsthaftem Gebrauch. Sie wurden als Kostbarkeit geschont, blieben
ansehnlich und galten schließlich als wertvoll genug, in einem
Museum ausgestellt zu werden. Zuallererst hatten sie jedoch einen
anderen tiefen Sinn: Es waren Werbegeschenke – natürlich
im alten ursprünglichen Sinn des Wortes – heute sagt man
lieber Freiersgaben, obwohl dieser Ausdruck mindestens ebenso
altmodisch ist, aber man muss sich ja absetzen von dem, was das Wort
„Werbung“
heute bedeutet.
Nicht
nur schöne geschmückte Mangelbretter verehrten die jungen
Männer früher ihren Angebeteten, auch andere Hausgeräte,
eben auch die Webekämme waren gern gesehen. Und zu diesem Zwecke
wurden sie so liebevoll verziert, mit dem Namen der Liebsten, mit
Jahreszahlen und Sinnsprüchen, mit Rosetten, Sonnen, Herzen,
Blumen, Vögelein, ja sogar Pferden oder Wappen, oder auch mit
ganz prosaischen Motiven wie stilisierten Garnknäulen.
Jedenfalls
hieß es im Volksmund: „Nimmt sie den Kamm, dann nimmt sie auch den
Kerl."
Dem jungen Mann sagte
man: „Eine Deern, die beim Bandweben die
Übersicht über die vielen Fäden behält, wird auch
die Fäden in einem großen Bauernhaushalt fest in der Hand
haben, du kannst sie getrost heiraten."
So
war das früher.
Ich
war schon 35 Jahre mit meinem Mann verheiratet, als ich die Bandweberei
entdeckte. Aber er wollte den Alten nicht nachstehen und sägte und schnitzte mir eigenhändig
einen
schönen Kamm. Das Material ist
amerikanischer Buchsbaum, ein Holz, das sich leicht verarbeiten lässt,
nicht zu faserig ist und doch Festigkeit genug hat. Uwe ist ja
eigentlich Metallhandwerker, aber als er -
zugleich mit mir - in den Ruhestand ging, bekam er Lust, sich mal an
Holz
zu versuchen. Die Verzierung habe ich selbst entworfen, sie sind aber viel
schöner geworden als meine Zeichnungen. Natürlich blieb es nicht
bei dem einem Kamm. Hier sind
sie alle 3:
|
Für
83 Fäden
|
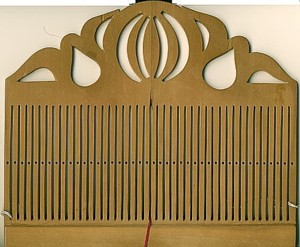 Für
83 Fäden Für
83 Fäden |

Für
51 Fäden |
Alle haben
unten eine dickere Kante, damit sie schön schwer auf der Kette hängen.
Bei dem Kleinsten binde ich trotzdem ein Gewicht in das Loch unten,
wenn
ich
mit sehr steifem Garn arbeite.
Uwe hat mir auch
einige Kämme aus Aluminium ausgesägt, mit denen es
sich sehr gut arbeiten lässt. Einer davon besitzt auch eine doppelte
Lochreihe zum Dreischaftweben. Man kann damit ganz einfache Muster sehr
schnell weben.
Eines Tage erzählte
mir eine Freundin, dass sie in Garding auf der
Halbinsel Eiderstedt im Schaufenster eines Antiquitäenhändlers "so ein
Ding wo du mit arbeitest" gesehen hatte. Sie hatte mir die Adresse
mitgebracht. Ein Telefonanruf, eine Überweisung, und ich wurde stolze
Besitzerin eines echten 200 Jahre alten Webekammes. Das musste gefeiert
werden!

Er
stammt aus Munkbrarup in
Angeln.
19 Löcher und 18 Schlitze, die interessanterweise gemeißelt und nicht
ausgesägt
sind, geben Platz für
37 Fäden, man kann also höchsten ein Muster mit 9 Fäden darauf weben.
Aber diese Art Kämme wurden nur selten für die kunstreichen gelesenen
Muster verwendet. Gewöhnlich webte man einfachen Kettrips darauf.
Ganz behutsam habe ich das
Bändchen mit 7 Musterfäden angefangen, damit er
nicht so nackt und bloß ist, denn das Holz ist sehr dünn und brüchig,
er
gehört nun wirklich in den Ruhestand. Ich habe ihn in einem
Bilderrahmen an die Wand gehängt.
Wer sagt denn,
wo hier oben oder unten ist?
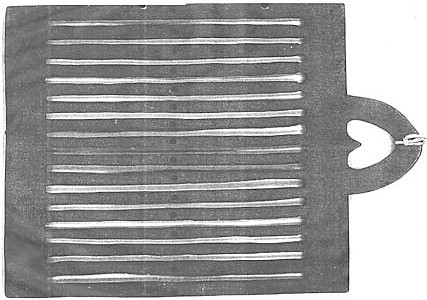 Kurz
danach entdeckte ich
hier in unserem Museum des Kreises Plön
Kurz
danach entdeckte ich
hier in unserem Museum des Kreises Plön
fast das gleiche Modell, es stammt
aus Wankendorf in Holstein.
Dieser Kamm ist
19x27 cm hoch,
rechteckig, auch mit einem Herzen.
Das Holz
ist sehr dünn und
vom Alter fast schwarz.
Er hat 16 Löcher und 15
Schlitze, Platz
für 31 Fäden.
Er ist auch gemeißelt,
nicht ausgesägt.
Im Museum trägt er ein Bändchen, das ich auf ihm angewebt habe,
damit man sieht, wozu
er auf der Welt ist.
Wichtig zu wissen ist:
Das Herz gehört beim Weben nach unten und wird mit
einem
Gewicht beschwert, weil sonst der leichte Kamm auf der Kette
zu tanzen anfängt, das stört bei der Arbeit.
Wird er gerade nicht gebraucht, dient das Herz als Aufhänger.
Beide Kämme stammen
aus dem 18. Jahrhundert. Ihre Form
scheint für Schleswig-Holstein typisch zu sein.
Nun denke bloß nicht, dass
ich eine fanatische Kammsammlerin geworden bin. Dazu hätte ich weder
den Platz noch die Euros.
Aber wenn ich mit den Augen
etwas stehlen kann, bin ich sofort dabei.
So kam ich innerhalb von 14
Jahren zu der nachfolgenden Bildersammlung. In jedem Urlaub nahm ich
meine Kamera mit in jedes Museum. Ein einziges Mal nur wurde mir das
Knipsen untersagt. Und öfter bekam ich auch mal ein Bild geschenkt,
Kopie vonner Kopie vonner Kopie... deshalb sind die Bilder auch
manchmal nicht gerade 1. Qualität. Aber trotzdem: Viel Spaß beim
Ansehen!
Du wirst hier vielen
schön
verzierten und nur wenigen ganz schlichten Kämmen begegnen. Im
Alltag
war dies Verhältnis genau umgekehrt, aber von den prächtigen
Webekämmen sind natürlich viel mehr in Museen gelandet, als von den
einfachen, praktischen Arbeitsgeräten. Die waren gewöhnlich
so lange im Gebrauch und wurden immer wieder geflickt, bis sie ganz
auseinander
fielen.
Lustig
finde ich, zu beobachten, dass die Weberinnen früher die Bruchstellen
an ihren Kämmen nicht geleimt, sondern zusammengenäht
haben. Auf dem Bild
von meinem alten Kamm ist das
deutlich zu sehen. Auf
vielen Bildern weiter unten kannst du auch Flickstellen
entdecken,
manchmal nur kleine Löcher rechts und links vom Bruch, oft ist
aber noch der Nähfaden vorhanden.
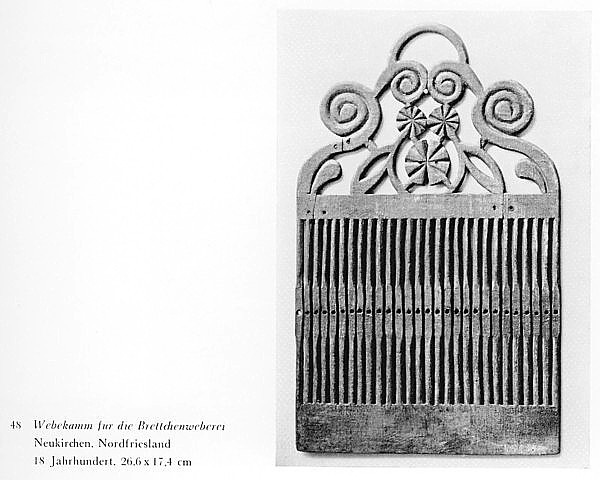 Museumsdirektoren
Museumsdirektoren
wissen
auch nicht
immer alles.
Dazu erlaube ich mir, hier ein
Beispiel aus dem Büchlein "Schleswig-holsteinische Volkskunst",
von Ernst Schlee, seinerzeit Landesmuseum
Schloss Gottorf in Schleswig, zu zeigen.
Dieser Webekamm war mit Sicherheit nicht für die
Brettchenweberei
verwendbar!
Siehe Bandweben, 2
Möglichkeiten
Aber ein
schöner Kamm ist das, und sicher
mit der Hand gemacht,viel
gebraucht und
auch schon geflickt.
!
Flensburg
Von meinem 1996 verstorbenen Schwiegervater habe ich ein
uraltes Buch (ohne Jahreszahl, ohne ISBN) geerbt "Kunsthandwerk in
Schleswig-Holstein" von Gustav Brandt, der meines Wissens Anfang des 20 Jahrhunderts Museumsleiter
in Flensburg gewesen ist. Darin fand ich
diese Webekämme. Leider fand ich sie aber bei 2 Besuchen
nicht im Museum in Flensburg. Vieleicht liegen sie im Archiv.
|
ORA & LABORA
1726 HR
|
LUST UND LIEBE ZUM DINGE
MAGET ALLE ARBEIT GERINGE
ANNO 1723 ANNA RORDEN
|
Flickstelle mit Blech beschlagen
|
1723
|
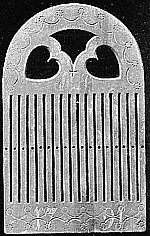
|
ANNO
1703 V + + V+R
|
ANNO 1723
|
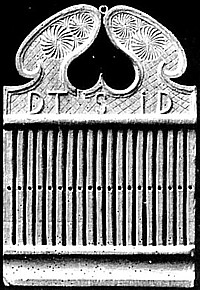
|
Ehemals
Ostdeutschland
Vorpommern
Die nächsten beiden Kämme
stammen aus dem Memelland,
..und
dieser aus
Mönchgut, Rügen, lag 1964 im
aus "Deutsche Volkskunst Ostpreussen" von Karl Heinz
Claßen 1926
Museum für
Deutsche Volkskunde, Berlin
|
Schwäne und Pferdeköpfe
|

|
Der viereckige Umriss
bleibt trotz der vielen
Verzierungen erhalten, diese Art ist typisch für Pommern
|
Dänemark
Jetzt
gehen wir nach Nordjütland, in das kleine Museum von Saeby, Hier findet
man die 100 Jahre alte Ausstattung einer ganzen Dorfschule. Dazu
gehören auch einige Bandwebkämme, welche ich durch die Glasplatte in
einer
Schublade fotografiert habe.
Im
Museum in Saeby gibt es überhaupt viel zu sehen. Es zeigt insbesondere
die
schwedischen Haarkullas, Künstlerinnen, welche Schmuck aus menschlichen
Haaren anfertigen.
Schweden,
Dalarna
Einige gibt
es heute noch, ja, ich habe eine echte Haarkulla
kennengelernt. Sie heißt Nina Sparr und wohnt in Dalarna, in Vaamhus am
Siljansee. Ninas verstorbene Mutter hat aber auch eine umfangreiche
Bandmustersammlung hinterlassen, denn neben der Anfertigung von
Haarschmuck ist rund um den Siljan die Bandweberei noch sehr lebendig.
7
kleine Museen haben wir dort besucht. Hier in diesem Kapitel zeige ich
nur die prächtigen Webekämme, die wir dort gesehen haben. Die Reise
"Rund um den Siljan" wird noch geschrieben.
Schwedisch Lappland
3Webekämme, die kunstvoll aus Rentiergeweih zusammengesetzt
sind, der mittlere und der rechte haben 2 Lochreihen
Norwegen
Wenn man in Telemark von
Tuddal aus weiterfährt am Bjaarsee entlang, vorbei am Gaustamassiv, hinauf in die Berge,
dann kommt man,
zuletzt nach
Bondal. Dort verwandelt
sich die Straße in
einen Wanderweg, der durch den Wald weiter hinauf ins Hochgebirge führt.
Der
ehemalige
Schmied von Bondal hat auf seine alten Tage ein Museum eingerichtet.
Nicht nur alte Landmaschinen und
Schmiedewerkzeuge, sondern alles, was er kriegen konnte, hat er
gesammelt.
Ich
entdeckte einige Gürtel und Haarbänder in
Brettchenweberei. Als ich ihn nach Werkzeugen zum Bandweben fragte,
zeigte er stolz auf einen Glaskasten:
Da standen drei urige Webkämme,
sicher die ältesten meiner ganzen Sammlung. Auch Schiffchen waren
dabei: Werkzeuge zum Bandweben wohl, aber Bänder dieser
Art findet man in der Gegend leider gar nicht mehr.
Das
Fotografieren bei der herrschenden Dunkelheit war nicht so einfach.
Meine Automatikkamera wollte erst knipsen, nachdem ich mit
Papiertüchern und Spucke den Staub von der
Glasscheibe gewischt hatte. Es gab auch starke Spiegelungen,
aber zum Glück nicht auf wichtigen Teilen. Alle drei Kämme waren aus
solidem, dunkelbraunem Holz, hatten Gebrauchsspuren und Flickstellen.
Auch dieser Kamm ist mit Fäden
geflickt
worden.
Hier ging der Bruch sogar quer zu den Kammzähnen.
Platz für
nur 27 Webfäden, also nur für ganz
schmale
Bänder geeignet. Darüber hängt ein Schiffchen.
|
An der
oberen
Verzierung zerbrochen und mit weißer Farbe bekleckst.
Im
unteren Querteil dunkler gefärbte Schnitzerei. 31 Fadenplätze
|
Am besten
erhalten aber auch mit einer Flickstelle
|

Und hier der
Königlich-Norwegische Superkamm
aus dem Norska Museet, Oslo
Er ist
sogar mit Bleigewichten beschwert, von denen eines fehlt.
Das
Bändchen,
was er trägt, ist seiner Pracht jedoch nicht angemessen.
Ob ich
mal
frage, ob ich Nachhilfeunterricht anbieten soll?
Das
Museum hatte 2002
eine sehr aufgeschlossene Handarbeitsstube -
Ein kleiner Gruß, sogar mit zweiter Lochreihe
aus
und einer aus
Finnland
Estland
Noch mehr Webekämme gibt es im Hesterbergmuseum
in Schleswig
Da möchte ich unbedingt noch mal hin, du auch?
dann klick mal drauf
Zurück zur Startseite



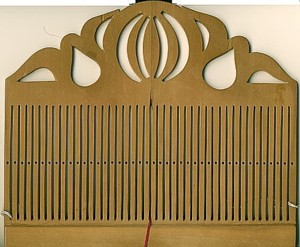 Für
83 Fäden
Für
83 Fäden 

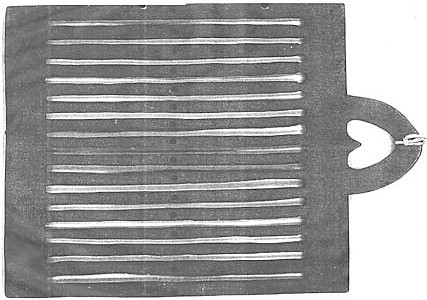 Kurz
danach entdeckte ich
hier in unserem Museum des Kreises Plön
Kurz
danach entdeckte ich
hier in unserem Museum des Kreises Plön 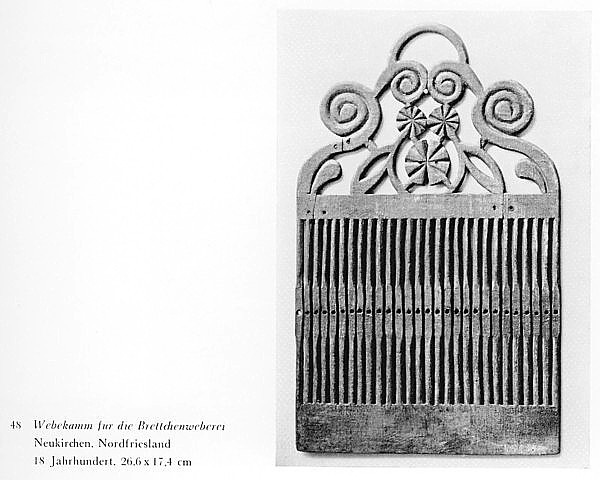 Museumsdirektoren
Museumsdirektoren