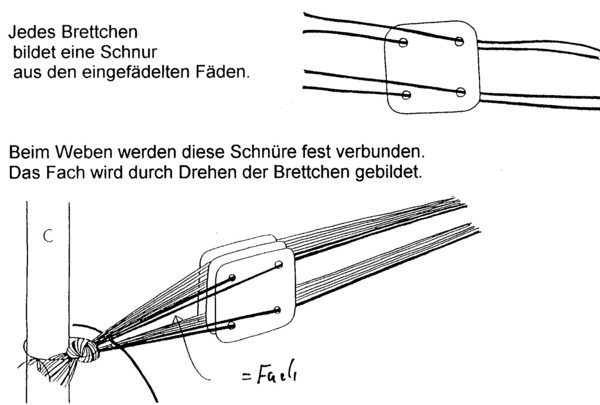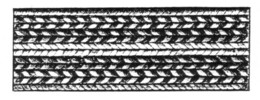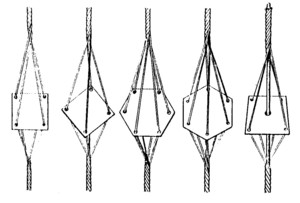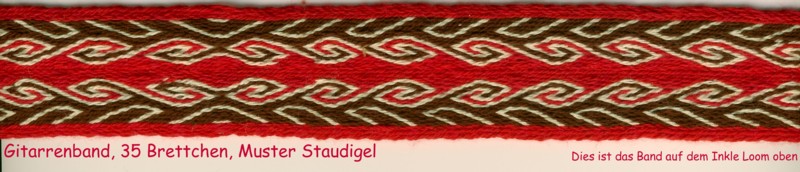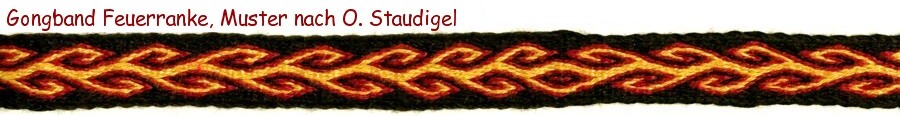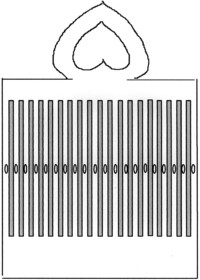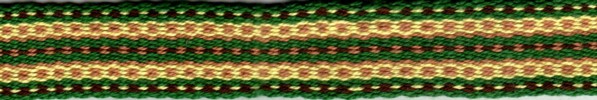Gewebte
Bänder von und bei Anneliese Bläse

IV. Bandweben,
2 Möglichkeiten
Zitat
aus einem Fachaufsatz über Webkunst im alten Ostpreußen, veröffentlicht
von der Landsmannschaft Ostpreußen 1984, als Beispiel für viele:
Sehr beliebt war früher
auch die Brettchenweberei, die ebenfalls nach Nordeuropa weist und
auf einer sehr hohen volkskünstlerischen Stufe stand. Vor allem
im nordöstlichen Ostpreußen webte man früher auf
solchen geschnitzten hölzernen Brettchen schmale, reich
gemusterte Schürzenbänder. (Zitat Ende)
Dieser kurze Text enthält
2 grundlegende Fehler, die zeigen, dass der Verfasser keine Ahnung
hatte, wovon er schrieb. Du magst mich für kleinlich halten,dass ich
mich so breit darüber auslasse, aber die Beschäftigung mit vielen Fäden
hat mich gelehrt, dass gewisse Dinge nur laufen, wenn man eine
bestimmte Ordnung einhält. Häufige Fragen von Webfreunden oder
solchen, die es werden wollen, zeigen die große Verwirrung, welche
durch unsachgemäße Beschreibungen und Verwendung falscher Begriffe
durch angebliche Fachleute angerichtet wurde und ständig noch wird:
1. Hier wird der Ausdruck
"Brettchenweberei" für die Kammweberei verwendet,
denn Webebrettchen waren nie geschnitzt, sie müssen so glatt wie
möglich sein, sonst laufen sie nicht.
2. Mit geschnitzten
Brettchen können nur die Wekekämme, auch Gatter, oder Gatterkämme, gemeint sein.
Damit wurden in Ostpreußen die Jostenbänder gewebt. Jousta ist litauisch und heißt
Gürtel, das waren sie auch, - keine Schürzenbänder.
3. In Schleswig-Holstein heißt der Webekamm auf Plattdeutsch
tatsächlich "dat Brett", weil er ja meist aus einem einzigen
Stück Holz hergestellt wurde.
Aber er heißt nicht Brettchen,
und wir weben auch keine Bändchen, wie es bei meinem letzten Auftritt im Textilmuseum Neumünster in der Einladung stand.
Die Interessierten dachten sofort "Freundschaftsbändchen" und gingen deshalb in die anderen angebotenen workshops.
Als Alles vorbei war, standen sie an meinem Tisch und staunten und
quakten:"Hätte ich das gewusst, wäre ich zu Ihnen gekommen."
Das war sehr erhebend für mich.
Also:
Der Verfasser jenes Artikels kannte weder die Verwendung noch die
landesübliche Bezeichnung für die Bänder.
Entweder war er kein
Ostpreuße, dann hat er schlecht recherchiert, und die Herausgeber haben
ihm nicht auf die Sprünge geholfen.
Oder er verhielt sich so, wie die berühmte Margarethe
Lehmann-Filhes
in ihrem Buch "Über Brettchenweberei" zwischen den Zeilen ihren Ehemann,
den Archäologen Filhés
und seine Kollegen beschreibt:
Kleine Dinge sind für große Männer unwichtig, sie fühlen sich über
Handarbeiten erhaben, belächeln die Frauen ob ihrer Wichtigtuerei wegen
Nichtigkeiten,
sagen beschwichtigend ja, ja - und gucken nur von sehr
weit oben herab und somit gar nicht richtig hin.
Deshalb habe ich diese
beiden völlig verschiedenen Webtechniken hier genau erklärt.
Es gibt
natürlich auch noch andere Webarten und Techniken. Einige findest du
unter
1.
Brettchenweben, auch Plättchenweben oder
Schnurweben
Margarete
Lehmann-Filhes hat 1902 mit der Veröffentlichung ihres Büchleins "Über
Brettchenweben" diese Webmethode wieder in den Blick der Wissenschaft
gerückt, nachdem sie in Europa nur noch ein verborgenes Dasein am Rande
- nämlich in so exotischen Gegenden wie auf dem Balkan, Lappland,
Island oder Ungarn -
geführt hat. Es ist ihr Verdienst, "die Männer", in diesem Falle ihren
Ehemann und seine Freunde, alles Archäologen und Forscher, immer wieder
auf diese kleinen Bändchen hinzuweisen als
wichtigen, wenn auch unscheinbaren, Bestandteil der alten Kulturen. Als
anständige Frau ihrer Zeit konnte sie ja nicht selbst mit auf Expeditionen fahren, Sie erinnerte sie daran und bat ständig
darum, ihr von den Reisen Bänder
mitzubringen. So kam sie zu einer schönen Sammlung, die sie genau
studierte und mit Hilfe von isländischen und anderen Freunden
herausfand, wie die Bändchen gewebt ware. Das beschrieb sie dann in
ihrem Büchlein, welches bis heute das Grundwerk zu diesem Thema ist und
immer noch zitiert wird. Vor einigen Jahren sah ich ihr Buch auf dem
Schriftentisch im Nordiska Museum in Stockholm in
Schweden, natürlich in
schwedischen Übersetzung. Vielleicht ist es da jetzt noch zu bekommen.
Hier in Deutschland ist es längst vergriffen - ja, als ich es mir von
der Stadtbücherei kommen ließ, durfte ich das "echt alte", kostbare
Exemplar nicht
einmal mit nach Hause nehmen, sondern musste es dort lesen.
Margarete, geborene Lehmann, verheiratete Filhes hat bei all ihrer
Forscherei nur hölzerne Webebrettchen zu sehen bekommen, deshalb nannte
sie die neue alte Technik, für die es in Deutschland nicht einmal mehr
einen
Namen gab "Brettchenweben". Inzwischen weiß man, dass es Webeplättchen
aus allerlei verschiedenen Materialien gegeben hat, zum Beispiel
Knochen, Elchgeweih, ja sogar hart
getrocknetes
Leder. Auf dem Balkan weben die Männer mit gebrauchten
Spielkarten, die
sie sich zurecht schneiden. Ein altes Spiel hält gerade noch ein
Band aus, sagt man. Wenn man heute neue Brettchen oder Plättchen
kaufen will, sind sie häufig aus einer steifen geölten Pappe,
die
mich sehr an die Isolierpappe in alten Radios erinnert. Aber für
den
Anfang
geht es auch mit quadratischen Bierdeckeln, die man im ganzen Block
unter die
Bohrmaschine legt, damit die Löcher schön
gleichmäßig werden.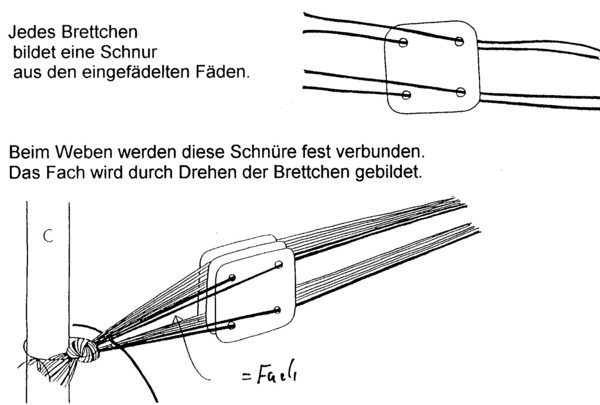
Jedes
dieser Brettchen hat 4 Löcher. Wenn ein Brettchen gedreht wird, bildet sich aus den eingefädelten Fäden eine gezwirnte
Schnur. Das
Webfach wird durch Drehen aller Brettchen gebildet, Eine ganze Umdrehung der Brettchen bildet 4 mal ein Fach.
Der
Schussfaden verbindet die
Schnüre aller Brettchen fest miteinander, so entsteht das Band.
Seine Struktur sieht anders aus, als
beim Kammband. Je nachdem, wie die
Fäden durch die Brettchen gezogen wurden und wie
oft sie in die gleiche Richtung gedreht wurden,
wirkt sie wie rechte
Strickmaschen oder wie
ein Köpergewebe.
In der Literatur ist viel von Köper die Rede, dabi müssen wir
immer im Auge behalten, dass es kein Köper ist, sondern nur
so ähnlich aussieht.
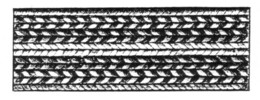
Brettchengewebestruktur
kann wie gestrickte
rechte Maschen
aussehen, es gibt aber
auch
andere Strukturen.
Über das Brettchenweben gibt es viele Veröffentlichungen,
siehe Links. Es wird gewöhnlich im Vergleich mit der Kammweberei als die schwierigere
Art (und deshalb edlere Handarbeit) dargestellt.
Aus
eigener Erfahrung möchte ich aber behaupten, schwieriger ist wohl
das Einfädeln und die körperliche Anstrengung beim Weben. Hat man die
Kette aber erst einmal vorbereitet, kann man bei vielen Mustern einfach
flott
darauf los arbeiten.
Die Gelesenen Muster beim Kammband verlangen dagegen während des ganzen
Webvorganges
eine gleich bleibende
Konzentration. Ich beschreibe die Brettchenweberei hier nur kurz und
konzentriere mich dann auf das Gebiet, welches ich am besten beherrsche: die Bandweberei mit
dem Webkamm, und besonders die Gelesenen
Muster
des Ostseeraumes.
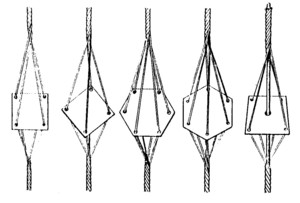
Webebrettchen haben ganz
verschiedene Lochzahlen, auch dreieckige, hier nicht abgebildet. Das
quadratische Brettchen ganz rechts mit dem Loch in der Mitte dient
dazu, die
einzelnen Schnüre zu verstärken, indem noch ein dickerer Faden
unsichtbar mit
eingearbeitet wird. Damit webt man zum Beispiel Pferdezaumzeug, auf dem
Balkan, früher auch in Finnland.
Der Gürtel des Dänenkönigs Eric ist sogar mit 8-Loch-Brettchen gewebt.
Die Umkehrstellen 
Das
Muster dieses blau-weiß-schwarzen Bandes wird
einmal bestimmt durch die Anordnung der Fäden, aber auch durch die
Richtung, in
welche die Brettchen gedreht werden. Dreht man sie eine Zeit lang immer
in eine Richtung, werden ja nicht nur die Fäden welche man verwebt, vor
den
Brettchen zu Schnüren eingedreht, sondern am fernen
Ende hinter den Brettchen geschieht
dasselbe. Irgendwann sind sie dort so stark eingedreht, dass man keinen
Spielraum zum Weben
mehr mehr hat. Ändert
man die Drehrichtung der Brettchen, wird diese Verdrehung wieder
aufgehoben. Dadurch entsteht aber eine deutlich erkennbare Umkehrstelle,
von der an das gleiche Muster spiegelverkehrt verläuft. Man kann
das Muster bewusst gestalten, indem man öfter die Drehrichtung ändert,
als es
eigentlich nötig ist. War zuvor ein
Winkel zu sehen, der sich von mir weg öffnete, so wird er sich jetzt
schließen. So entstehen die "Augen", und auch die Teile dazwischen.
Oben
habe ich die Umkehrstellen angezeigt: Großes Auge, längerer Abstand -
kleines Auge kürzerer Abstand.
Das Buch "Der Zauber des Brettchenwebens" von Otfried Staudigel
hatte auf mich die zauberhafte Wirkung, dass ich einige Dinge
endlich begriffen habe, aus denen ich früher nach anderen Anweisungen
einfach nicht schlau geworden bin. So weiss ich jetzt endlich, wie ich
leicht und schnell man eine Kette schären und dabei gleichzeitig die
Brettchen einfädeln kann. Ich besitze zwar kein Schärbrett, aber einen
Inkle Loom. "Deit dat sölbe!" sagt man auf Platt. Und nach Anweisung
von Herrn Staudigel gelangen mir auch schon einige Muster aus der
Sippschaft des "Laufenden Hundes", (beliebt bei den alten Griechen), bei
welchen man die Brettchen
gruppenweise in verschiedene Richtungen drehen muss. Dazu gehören,
siehe unten, der Henkel des grauen Beutelchens mit der
braun-grünen Ranke auf dem großen Bild, sowie weiter unten das
Gitarrenband und das
Gongband mit der Feuerranke. Danke, Herr Staudigel!
Zu Otfried Staudigel,
Brettchenbandweber, kommt man per E-mail: staudigel@brettchenweben.de
Blick in
meine Brettchenwerkstatt
Brettchenweben mag ich am
liebsten auf meinem kleinen Schottischen Bandwebstuhl, dem Inkle Loom.
Man kann darauf die Kette schären und dann gleich darauf los
weben. Näheres unter Werkzeuge - Link -
Meine
Brettchen hat
mir mein Mann aus
Brasilianischem Buchsbaum
gemacht, ganz dünnes Holz, ganz fein geschliffen, sie laufen wunderbar!
Die
großen "Sicherheitsnadeln" hat er mir aus rostfreiem Stahldraht
gebogen, in verschiedenen Größen für verschiedene Brettchenzahlen. Die
Idee, die Brettchen auf diese Weise vor dem Durcheinanderfallen zu
sichern, ist sehr praktisch. Sie stammt von der schwedischen
Bandweberin Sonja Berlin Englund
aus ihrem Buch «Brickvävning - så in i Norden» (Text Schwedisch).
Auch das vorne liegende Schiffchen mit dem blauen Garn hat mein Mann
aus Brasilianischem Buchsbaum gemacht. Diese
Form wird in Telemark, in Norwegen verwendet, gewöhnlich mit einer
Einlage aus Eisen oder Messing. Das Schiffchen, das in der
aufgespannten Kette steckt, gehört zum Inkle Loom. Es eignet sich nicht für Lesemuster.
Seit ich das Buch von Otfried Staudigel «Der Zauber des
Brettchenwebens» (Text Deutsch und Englisch) besitze, habe ich mich
sogar an das alte Muster der Griechen und des Balkans, den «Laufenden
Hund» und seine Verwandten gewagt. Die
braun-grüne Ranke auf dem Taschenhenkel und das Band auf dem Inkle Loom
gehören dazu.
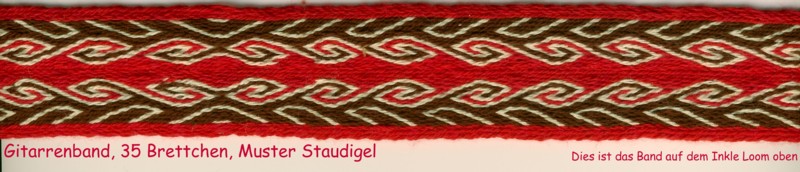
Für Sohn Martin webe ich Griffbänder für die Gongs, die er
schmiedet, hier ein Beispiel:

Hier unten
mein neuestes, ein Band für Martins größten Gong
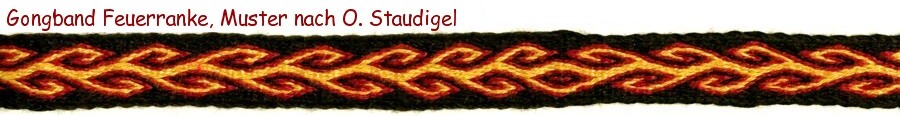
Link zu Martin
2b. Kettripsband
mit dem Webekamm
auch Bandwebe, Gitter, Gatter, auf
Pommersch Platt einfach „dat
Brett“ genannt.
Seit ich mich mit
dieser Website beschäftige, bemühe ich mich, Webekamm zu sagen, weil
der Komputer sonst falsche Assoziationen entwickelt, er meint, ich weiß
nicht wie man webcam schreibt. Webkamm - Webekamm , beides ist
gebräuchlich gewesen,
abhängig von der Landschaft
Man will uns Kammwebern immer
einreden,
dass die Brettchenweberei die Ältere und deshalb Fürnehmere ist unter
den
beiden Künsten. Niemand
weiß, wann der
Webekamm erfunden worden ist. Aber immerhin hat man Stücke von
zerbrochenen
Webekämmen bereits aus der Römerzeit gefunden, das heißt sie sind
mindestens 2000 Jahre alt, also doppelt so alt wie die Wikinger, die
sonst
immer
für alles herhalten müssen.
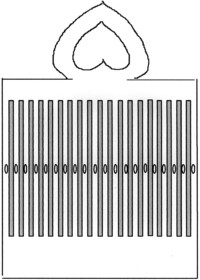
Die Löcher des Kammes ersetzen den alten Litzenstab, das heißt, die
Kettfäden, welche früher durch Litzen (Garnschlingen) liefen, sind nun
in die
Löcher eingezogen
und die freien Fäden in die Schlitze zwischen den Zähnen. Damit ist die
Kette auch
in 2 Gruppen aufgeteilt, eine feste und eine bewegliche, die sich
beim Weben kreuzen. Das
Webefach, der dreieckige Raum zwischen den beiden Fadengruppen,
wechselt
man durch Heben und Senken des Kammes. Die Fäden, welche durch die
Löcher
laufen, werden auf und
ab bewegt, und jedesmal, wenn sie ganz unten oder ganz oben sind, wird
das
Schiffchen mit dem Schussfaden durch
das „Fach“ geführt und fest angeschlagen. Wird das Fach
gewechselt,
bilden die Fäden ein neues Kreuz und der Schussfaden kann nicht
mehr zurück: Diese geniale Erfindung der
Menschheit wurde schon vor mehr als 5 000 Jahren gemacht.
Unten auf dem Bild
sieht man das künstliche Fach, der Kamm ist hier
angehoben und das Schiffchen ins Fach eingeführt. Hängt der Kamm unten,
sind die Lochfäden auch unten, hat man das natürliche Fach.
Das entstehende
Gewebe hat eine Leinenbindung: die Fäden laufen in jede
Richtung immer 1 drunter, 1 drüber. Allerdings, beim
Bandweben wird der
Schussfaden so fest angezogen, dass
er
nicht gar mehr zu sehen ist. Nur die
Kettfäden sind sichtbar und sie bestimmen das Muster. Das Gewebe hat
Querrippen, je dicker das Schussgarn, um so deutlicher zu sehen. Darum
heißt es es Kettrips.
Achtung! Beim
großen Webstuhl hat man zum Anschlagen einen Kamm, aber nie
beim Bandweben!
Da macht man es mit dem Schiffchen oder einem
Holzschwert, der Kamm spreizt die Fäden, das soll er nicht.
fernes
Ende, an der Wand befestigt
Arbeitsseite,
am Gürtel befestig
Hier zwei Beispiele:
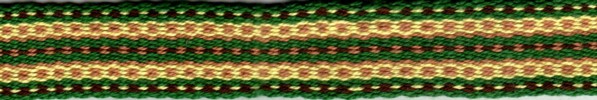
Schlicht
Weben oder Schussband: das bunte
Muster hier entstand nur durch die Anordnung der Kettfäden

Band mit
gelesenem Muster im Stil des Ostseeraumes, 21 rote Musterfäden , 42
weiße Grundfäden
weiter:
Bandweben
mit Webekamm und Rückengurt
weiter: Der
Webekamm
zurück zur Einführung
zurück zur
Startseite